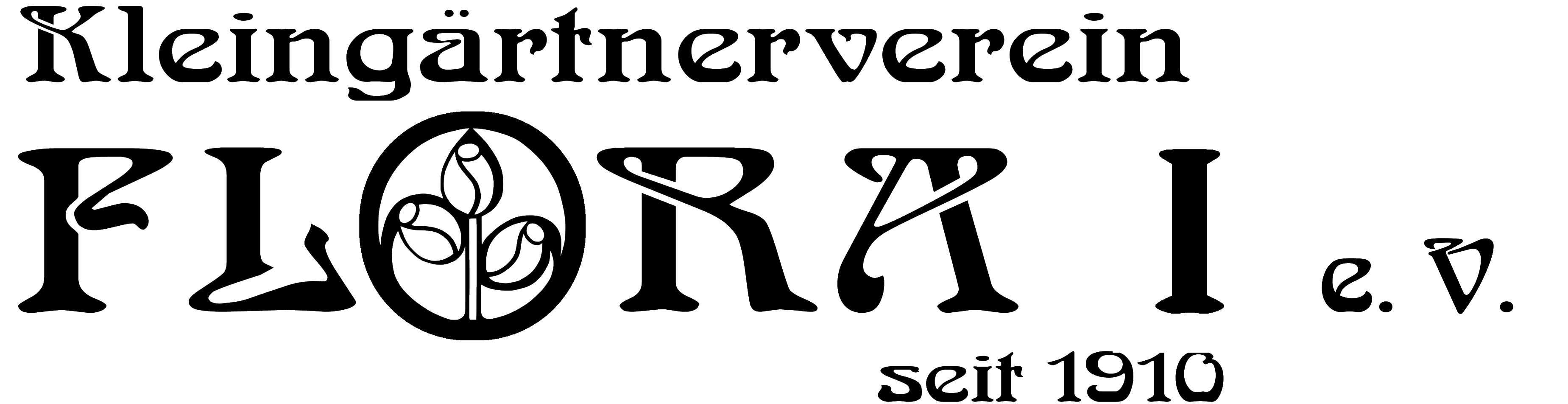Beetvorbereitung im Frühjahr: Solange es noch kalt ist, sollte die vom Herbst verbliebene Gründüngung abgerecht, beziehungsweise oberflächlich eingearbeitet werden. So kann sich die Grünmasse bei steigenden Temperaturen rechtzeitig vor Aussaatbeginn zersetzen und eine ausreichende Versorgung für alle Schwach- und Mittelzehrer bieten. Eine Zusatzdüngung benötigen lediglich noch die Starkzehrer, also Tomaten, Kohl, Gurken oder auch Kürbisse. Für eine erfolgreiche Aussaat muss der Boden gut abgesetzt sein. Denn nur dann haben sich Kapillarröhrchen gebildet, die Samen und Keimlinge aus tieferen Bodenschichten heraus mit Feuchtigkeit versorgen. Daher sollte der Boden im Frühling nur ganz oberflächlich, circa 3–5 cm tief, gelockert werden. Jede tiefere Bodenbearbeitung führt zu einer Unterbrechung dieses Wasserzuflusses von unten, der durch Gießen von oben nicht ersetzt werden kann: Ein Vertrocknen der empfindlichen Keimlinge wäre die Folge. Anschließend muss dann noch ein bis zwei Wochen gewartet werden, damit sich der Boden wieder setzen kann, so dass keine Hohlräume zurückbleiben, die das Pflanzenwachstum behindern könnten. Wenn sich der Boden dann endlich ausreichend erwärmt hat, wird in flache Rillen gesät, mit lockerer Erde abgedeckt und anschließend für einen besseren Bodenschluss der Samen mit dem Rechen gut angedrückt. Spinat, Rettich und Dicke Bohnen können als erste gesät werden, gefolgt von Salat, Möhren und Zwiebeln am Ende des Monats.
Düngen im Kleingarten Da wir im Kleingarten in erster Linie für den Eigenbedarf produzieren, ist es nicht nötig, zur Ertragsmaximierung im Frühling großzügig Blaukorn oder anderen Kunstdünger auf die Beete zu werfen. Als organische Alternativen bieten sich Rinder- oder Pferdedung sowie Schafwolle an (alle drei sind in Pelletform erhältlich), die zudem den Vorteil haben, sich im Boden langsam zu zersetzen, so dass ihre Nährstoffe über einen längeren Zeitraum hinweg zur Verfügung stehen. Für Veganer gibt es aus Klee hergestellten Dünger (Kleepura), der wirklich gut riecht, nämlich nach Heu, aber zu teuer ist, um ihn auf allen Flächen anzuwenden. Ebenfalls nicht vom Tier sind auf der Basis von Melasse hergestellte Flüssigdünger, die ebenfalls gut riechen, aber etwas klebrig sind. Kompost und Jauchen entstehen aus Rohstoffen, die uns der Garten selbst zur Verfügung stellt, kosten also nichts und sorgen zudem dafür, dass der Garten nicht mit prall gefüllten Müllsäcken verlassen werden muss. Ohnehin produziert ein Garten keinen zu entsorgenden Abfall, sondern ernährt sich in einem Kreislauf von Wachstum und Zersetzung selbst. Bis auf sehr wenige Ausnahmen lassen sich die im Garten anfallenden „Reste“ kompostieren oder weiternutzen. Ausgezupftes Unkraut, Grasschnitt oder die äußeren unansehnlichen Blätter von Kohl oder Salat können dünn ausgebracht als Mulch zwischen den Gemüsereihen verwendet werden und schützen so den Boden. Jauche aus Brennnesseln stinkt zwar entsetzlich, vertreibt aber Blattläuse und ist zudem durch ihren hohen Stickstoffanteil ein guter Dünger. Beinwell und Schachtelhalm enthalten viel Kieselsäure, die die pflanzlichen Zellwände stärkt und so die Widerstandsfähigkeit gegen Pilzerkrankungen erhöht. Beinwell eignet sich wegen seines hohen Kaliumgehalts zudem besonders gut zur Düngung kaliumbedürftiger Pflanzen wie Kartoffeln, Tomaten oder Sellerie. Kamillenjauche hilft gegen wurzelbürtige Krankheiten. Regelmäßige Kompostgaben tragen zum Aufbau der Humusschicht bei und verbessern so nachhaltig die Bodenstruktur und die Wasserhaltefähigkeit.
Vorgekeimte Frühkartoffeln bringen einen höheren Ertrag, zudem verfrüht sich der Erntebeginn um etwa zehn Tage. Zum Vorkeimen legt man die Kartoffeln Anfang März in Saatschalen oder Eierkartons und stellt sie in einen hellen ungeheizten Raum. Die optimale Temperatur liegt bei 10 bis 15 °C. Es bilden sich bald Triebe, die nach dem Auspflanzen bei einer Bodentemperatur von etwa zehn Grad sofort weiterwachsen. Eine Abdeckung mit Vlies oder Lochfolie bietet günstige Bedingungen, so dass bereits Anfang Juni geerntet werden kann.
Zur Teichfauna gehören auch Libellen, daher folgt in diesem Monat noch ein Nachtrag. Eine erstaunliche Anzahl dieser auffälligen (und großen) Insekten gibt sich zur Eiablage mit der vergleichsweise winzigen Wasserfläche eines Gartenteichs zufrieden. Dort verbringen die Larven im Durchschnitt ein bis zwei Jahre, in denen sie sich als Räuber von Mückenlarven, Bachflohkrebsen oder auch Kaulquappen ernähren und ungefähr zehnmal häuten. Nach Ablauf dieser Zeit kommen sie aus dem Wasser, heften sich zum Beispiel an einen Pflanzenstengel, um dann nach einer letzten Häutung als fertiges Insekt aus ihrer Larvenhaut zu schlüpfen. Als Imago haben sie anschließend sechs bis acht Wochen Zeit, um sich fortzupflanzen. Libellen können ihre beiden Flügelpaare unabhängig von einander bewegen, was sie dazu befähigt, in der Luft stehenzubleiben sowie sehr schnell ihre Flugrichtung zu wechseln und das bei Höchstgeschwindigkeiten von bis zu fünfzig Stundenkilometern. Sie ernähren sich von anderen Insekten, die sie im Flug mit ihren zu einem Fangapparat umgebildeten Beinen ergreifen, und werden ihrerseits vor allem von Fröschen, Fledermäusen und Vögeln gerne verzehrt.